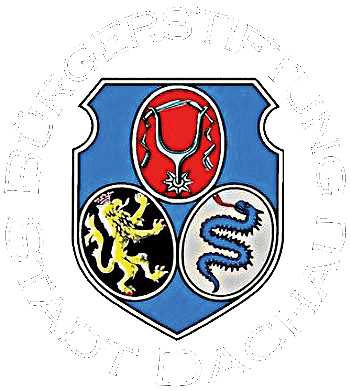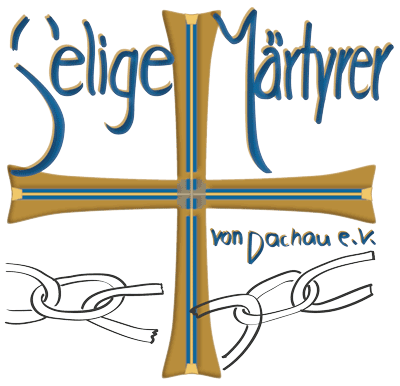Zu den Fotos:
Vor dem Münchner Polizeipräsidium v.r.n.l.: Sadija Klepo, Ludwig Spaenle MdL, Michael Dibowski, Pater Martin Stark SJ, Bernd Posselt, Stephanie von Waldburg-Zeil, Johannes Modesto, Anastasia Dick und Walburga von Lerchenfeld.
In dieser Straße stand das Elternhaus von Fritz Gerlich. Paneuropa-Delegation v.l.n.r.: Johannes Kijas, Stephanie Waldburg-Zeil, Bernd Posselt.
Im Stettiner Marienstift-Gymnasium ging Fritz Gerlich zur Schule. Paneuropa-Delegation v.l.n.r.: Johannes Kijas, Stephanie Waldburg-Zeil, Bernd Posselt.
90 Jahre nach seiner Verhaftung:
Gedenken an den Münchner
NS-Gegner Fritz Gerlich
München. Am 9. März vor 90 Jahren ließ Adolf Hitler Bayern gleichschalten, machte den späteren Massenmörder Heinrich Himmler zum Münchner Polizeipräsidenten, und die SA verwüstete die Redaktionsräume der christlichen Wochenzeitschrift "Der Gerade Weg" in der Münchner Hofstatt. Deren Chefredakteur, Fritz Gerlich, einer der bekanntesten Journalisten in Deutschland und vehementer Kämpfer gegen den Nationalsozialismus, wurde zusammengeschlagen und im Polizeipräsidium in der Ettstraße inhaftiert, bis er 16 Monate später zur Ermordung ins KZ Dachau verbracht wurde.
Zur Erinnerung daran veranstaltete die Paneuropa-Union Deutschland jetzt einen Gedenkakt vor dem Münchner Polizeipräsidium, bei dem ihr Präsident Bernd Posselt, MdEP a.D., der Beauftragte der Bayerischen Staatsregierung für Jüdisches Leben und gegen Antisemitismus, für Erinnerungskultur und geschichtliches Erbe, Dr. Ludwig Spaenle MdL, Polizeivizepräsident Michael Dibowski und der Postulator des Seligsprechungsprozesses für Fritz Gerlich bei der Erzdiözese München und Freising, Dr. Johannes Modesto, sprachen. Einen Gottesdienst zu Ehren Gerlichs in der benachbarten St.-Michaels-Kirche hielt Kirchenrektor Pater Martin Stark SJ.
Posselt wies in seiner Rede darauf hin, daß der katholische NS-Gegner Fürst Erich von Waldburg-Zeil für Gerlichs Kampf gegen Hitler 1930 eigens eine Zeitschrift erworben habe, die der "Führer" wegen zahlreicher Enthüllungen über ihn und seine Partei gehaßt habe wie kein anderes Medium. Der im pommerschen, heute polnischen Stettin geborene Gerlich sei schon als Chefredakteur der Münchner Neuesten Nachrichten ein Befürworter von Demokratie und Menschenrechten gewesen und habe sich vom Nationalkonservativen zum überzeugten Europäer gewandelt. Wie sein Verleger Waldburg-Zeil habe er nach 1927 zum Konnersreuther Kreis um die stigmatisierte Oberpfälzerin Therese Neumann gehört und mit weiteren Mitkämpfern den Naturrechts-Gedanken als christlich-freiheitliches Gegenmodell zum Nationalsozialismus und zum Kommunismus empfohlen.
Staatsminister a.D. Ludwig Spaenle prangerte den Zivilisationsbruch an, den die NS-Herrschaft in Deutschland herbeiführte. Mit unvorstellbarer Tapferkeit und beispielloser Wortgewalt habe Gerlich dies schon im Vorfeld von Hitlers Machtergreifung zu verhindern versucht und dafür gleich am Anfang der NS-Herrschaft mit seiner Freiheit und ein Jahr später mit seinem Leben bezahlt. Damit sei dieser ausschließlich der Wahrheit und dem Recht verpflichtete Journalist zum Vorbild für spätere Generationen geworden, zumal in der Gegenwart Freiheit und Menschenrechte wieder massiv bedroht seien.
Polizeivizepräsident Michael Dibowski verwies auf den abgrundtiefen Gegensatz zwischen der damaligen Unrechts- und Willkürherrschaft eines Polizeipräsidenten Heinrich Himmler und der Polizei von heute, die im Dienst des demokratischen Rechtsstaates stehe. Damals habe man sich nicht auf die Schutzfunktion des Staates verlassen können, der Staat sei vielmehr zum Täter geworden. "Gerlich hatte den Mut zu sagen, was er gesehen hat, und den Weitblick, zu schreiben, was auf Deutschland zukommen würde; und er war aufrecht genug, in seiner Überzeugung nicht zu wanken." Die Freiheit, die wir heute genießen, sei mit unfaßbaren Leiden von Persönlichkeiten wie Gerlich erkauft.
Johannes Modesto legte dar, daß Fritz Gerlich und Fürst Erich von Waldburg-Zeil am 8. März 1933 durch eine Intervention beim württembergischen Ministerpräsidenten Eugen Bolz versucht hätten, die Gleichschaltung Süddeutschlands noch abzuwenden und mit brisanten Unterlagen über die NSDAP, die sie mit sich führten, den Reichspräsidenten Paul von Hindenburg gegen Hitler in Stellung zu bringen. Dies sei gescheitert, und schon 24 Stunden später hätten die Braunhemden die Redaktion des Geraden Weges gestürmt. Modesto zitierte Zellennachbarn von Gerlich in der Ettstraße, die von seinem unerschütterlichen christlichen Glauben auch in den schwierigsten Notsituationen berichteten. Der Postulator verlieh seiner Hoffnung Ausdruck, daß in zehn Jahren, wenn es gelte, Gerlichs 150. Geburtstag sowie den 100. Jahrestag seiner Festnahme zu begehen, dieser bereits seliggesprochen sein werde.
Mit der Niederlegung von Blumen für Fritz Gerlich endete die Gedenkstunde, an der auch drei Enkel von Fürst Erich von Waldburg-Zeil teilnahmen: Freifrau Walburga von Lerchenfeld, Gräfin Stephanie Waldburg-Zeil sowie Prinz Erich von Lobkowicz mit seiner Tochter Ludmilla und seiner Nichte Ida. Weitere Ehrengäste waren der Münchner Stadtrat Michael Dzeba und die Enkelin von Gerlichs Mitverschwörer Hans-Georg von Mallinckrodt, Dominique von Herzogenberg. Die Paneuropa-Fahnen trugen die bosnische Journalistin Sadija Klepo, die Vorsitzende der Pontos-Griechen in München, Anastasia Dick, sowie als Repräsentantin der assyrischen Christen Janet Abraham.
In der anschließenden Messe in St. Michael würdigte Pater Martin Stark Gerlich als Märtyrer von Dachau, der für seinen Glauben Zeugnis abgelegt habe. Die SA-Männer hätten bei der Zerstörung der Redaktion des "Geraden Weges" mit Stiefeln auf Gerlichs Händen herumgetrampelt, damit er nie mehr schreiben könne. Dennoch sei seine Botschaft heute lebendiger denn je.
Im Vorfeld der Veranstaltung war eine Delegation der Paneuropa-Union Deutschland mit deren Präsident Bernd Posselt, Bundesgeschäftsführer Johannes Kijas und Pressereferentin Stephanie Waldburg-Zeil, in Gerlichs Geburtsstadt Stettin gereist, um an seinen 140. Geburtstag im Februar zu erinnern. Sie besuchten sein Elternhaus in der früheren Hohenzollernstraße sowie das berühmte Marienstiftsgymnasium, in dem er zur Schule ging. Posselt nannte es als Ziel, Gerlich auch in Polen bekannter zu machen: "Damit wird er lange nach seinem gewaltsamen Tod eine wichtige Rolle bei der deutsch-polnischen Verständigung und Versöhnung spielen."
Bildtexte:
171832.jpg (Foto Johannes Kijas): Vor dem Münchner Polizeipräsidium v.r.n.l.: Sadija Klepo, Ludwig Spaenle MdL, Michael Dibowski, Pater Martin Stark SJ, Bernd Posselt, Stephanie von Waldburg-Zeil, Johannes Modesto, Anastasia Dick und Walburga von Lerchenfeld.
120010.jpg (Foto Paneuropa): In dieser Straße stand das Elternhaus von Fritz Gerlich. Paneuropa-Delegation v.l.n.r.: Johannes Kijas, Stephanie Waldburg-Zeil, Bernd Posselt.
151706.jpg (Foto Paneuropa): Im Stettiner Marienstift-Gymnasium ging Fritz Gerlich zur Schule. Paneuropa-Delegation v.l.n.r.: Johannes Kijas, Stephanie Waldburg-Zeil, Bernd Posselt.
Quelle:
Paneuropa-Pressestelle, Dachauer Str. 17, 80335 München
Tel. 089/554683, Fax 089/99954914,
Der Todeszug aus Buchenwald
Von Klemens Hogen-Ostlender
Bahnhof Weimar, 7. April 1945, acht Uhr abends. In einem Sonderzug warten 5009 Männer, exakt abgezählt, auf die Abfahrt. Sie sind nach sechs Kilometern Fußmarsch, den 71 Kameraden nicht überlebt haben, hier angekommen. SS-Männer haben sie erschossen oder erschlagen. Die 5009 sind Häftlinge aus dem KZ Buchenwald. Sie sollen vor den anrückenden amerikanischen Truppen in „Sicherheit“ gebracht werden. Zusammengepfercht in 54 geschlossenen Viehwaggons und offenen Güterwagen. Der Transport wird als Todeszug in die Geschichte eingehen. Als er am 28. April in Dachau ankommt, werden noch 816 Überlebende registriert.
Dies ist die Geschichte von neun französischen Häftlingen, die das Schicksal an diesem Abend am Bahnhof zusammengeführt hat. Sie haben eines gemeinsam: Den Grund ihrer Gefangenschaft, sie weigerten sich, ihren katholischen Glauben zu verleugnen. Für die fünf von ihnen, für die diese Zugreise eine Reise in den Tod war, laufen heute Seligsprechungsverfahren als Blutzeugen für Christus. Die vier, die für Frankreich gekämpft haben, sind 1940 in Kriegsgefangenschaft gekommen. Aus verschiedenen Lagern im Rheinland werden alle ins Gestapogefängnis Brauweiler bei Köln eingeliefert und landen schließlich im KZ Buchenwald: René Boitier, 1917 geboren im Raum Paris, Philippe Bouchard, der 1916 in Nantes zur Welt kam, Raymond Louveau, geboren 1913 im Rand der französischen Hauptstadt, und Jean Préhu, Jahrgang 1920, der aus Laval im Nordwesten des Landes kommt. Alle gerieten als katholische Pfadfinder ins Visier der Gestapo.
Vier weitere werden als Seminaristen des franziskanischen Studienhauses in Carrières-sous-Poissy bei Paris 1943. Sie wurden zur Zwangsarbeit im Gebiet um Köln verschleppt, ebenfalls nach Brauweiler eingewiesen und dann in Buchenwald eingekerkert: Louis Paraire (Geburtsname Joseph, geboren 1919 im Vincennes im Weichbild der französischen Metropole, Eloi Leclerc, den seine bretonischen Eltern 1921 auf den Namen Henri tauften, Daniel (ursprünglich Jean) Verbraecken, zur Welt gekommen 1920 in Roubaix an der belgischen Grenze und der ebenfalls aus dieser Stadt stammende 24-jährige Jean-Pierre (René) Fourmentraux. Pierre Harignordoqui, geboren 1910 im unmittelbar an der spanischen Grenze gelegenen Dorf Saint-Étienne-de-Baïgorry, wird als „politischer Franzose“ als Pfarrer von Espelette im Baskenland 1944 verhaftet und kommt ebenfalls nach Buchenwald. Er gibt sich dort nicht als Priester zu erkennen. Dieses KZ hatte mehr als 150 Außenlager. Häftlinge müssen dort bis zur Erschöpfung in der Rüstungsindustrie arbeiten. Die Zahl der Todesfälle war vergleichsweise „niedrig“.
Der Grund: Wer arbeitsunfähig wird, wird zum Sterben ins KZ Buchenwald zurückverlegt.
Wie Vieh zusammengepfercht
Pierre Harignordoqui versucht beim Marsch zum Bahnhof wenige Meter vor dem Ziel, einen Kameraden, der nicht mehr kann, zu ermutigen: „Auf Marcel, eine letzte Anstrengung für deine Mama – wir kommen an den Bahnhof!“ Doch ein SS-Mann jagt dem Freund eine Kugel in den Kopf. Der Pfarrer brütet viele Jahre später: „Oft frage ich mich seitdem, warum er nicht anschließend mich erschoss“.
An die hundert Mann werden jeweils in einen Waggon gesperrt. In den offenen, von Kohlenstaub verdreckten Wagen, sind die Gefangenen schutzlos der Witterung ausgesetzt. In den Viehwaggons ist die Luft von Ausdünstungen hundert gequälter Leiber durchsetzt. 18 Quadratmeter Bodenfläche hat jeder Waggon. Ein Viertel der Fläche ist jeweils für zwei SS-Wachen reserviert. Sieben Häftlinge sind so auf jedem Quadratmeter zusammengepfercht.
Die Deutsche Reichsbahn lässt sich den Todeszug übrigens wie damals üblich bezahlen. Nicht zum Frachttarif für Güterzüge, sondern für jeden Häftling wie im normalen Personenzug – aber zum Tarif für Gruppenreisen.
Das KZ Flossenbürg,150 Kilometer südöstlich, ist Ziel des Transports. Trotzdem geht die Fahrt zunächst in Richtung Leipzig, nach Nordosten – möglicherweise aus Furcht vor den sich aus Südwesten nähernden US-Truppen, oder um zerstörte Bahnanlagen im Reichsgebiet zu meiden. Eloi Leclerc, der in einem offenen Wagen sitzt, erinnert sich später:
„Der furchtbare Alptraum hatte begonnen. Der Zug rollt langsam durch die Nacht. In der drangvollen Enge war es unmöglich, auch nur ein Bein auszustrecken“. Die Häftlinge hocken auf dem Boden, „eng zusammengepresst, ein Kamerad zwischen den Beinen, wie Skelette, die ineinander verschachtelt waren. Einige unter uns haben zum Glück eine Decke mitnehmen können. Zu dieser Jahreszeit waren die Nächte in Deutschland noch sehr kalt.“
Während der vielen langen Halts „mussten wir weiter am Boden hocken. Nur schnell und verstohlen, mit gesenktem Kopf, konnten wir aufstehen und die Gefäße nach draußen entleeren, in die wir unsere Notdurft verrichteten“.
Mitten durch Großstädte
Nach sechs Stunden schon kommt die Nachricht, Flossenbürg sei bereits in amerikanischer Hand. Das ist falsch. Das KZ wird erst 13 Tage später befreit. Trotzdem wird der Zug erst einmal einen vollen Tag lang gestoppt. Frühmorgens am 9. April geht es weiter. Mitten durch zwei Großstädte, Leipzig und Dresden. Soweit nach Osten, dass Pierre Harignordoquy sich schon fragt, „ob sie uns an die russische Front fahren und uns Befestigungen machen lassen wollen“.
Bei Leipzig wurden die ersten Toten neben dem Schienenstrang verscharrt. Die defekte Lok muss ausgetauscht werden. Reparaturen am stark zerstörten Eisenbahnnetz zwingen zum Warten. Kriegswichtige Transporte haben Vorrang. Der französische Häftling François Bertrand, Mitglied der Katholischen Aktion und wegen seiner Tätigkeit unter nach Deutschland verschleppten Landsleuten zum Tode verurteilt, führt über alle Bewegungen auf Zetteln Buch. Bei der SS fällt irgendwann der Entschluss: Nach Dachau. Der nächste größere Halt ist das tschechische Nýřany (Nürschan) bei Pilsen, 150 Kilometer südwestlich von Dresden. Es wird am 11. April erreicht. Einheimische riskieren die Todesstrafe, indem sie den Häftlingen Lebensmittel zustecken. Trotzdem herrschten Hunger und Durst im Zug. So viele sterben nun, dass keine Zeit bleibt, sie zu begraben. Die Leichen werden in Waggons am Zugende gesammelt.
Als erster der neun Franzosen starb Philippe Bouchard am 12. April in Nýřany. In seinem Waggon hat sich ein verhungernder Häftling auf einen Wachposten gestürzt, um ihm das Essen zu entreißen. Zwei SS-Männer erschießen daraufhin die meisten Insassen des Waggons, darunter Bouchard und auch Raymond Louveau. Manche Quellen nennen für ihn den 18. oder 28. April als Todesdatum, erwähnen dabei aber die Schießerei vom 12.
Am 13. April geht es nach Stod (Staab). Dort kommt der Zug nach nur 15 Minuten an und hält wieder bis zum übernächsten Tag.
Lernen, was im Menschen ist
Eines ist für Eloi Leclerc besonders schlimm:
„Das, was wirklich weh tat, ganz furchtbar weh tat, das war, wenn man sich selbst dabei ertappte, einen Sterbenden zu beobachten mit dem Hintergedanken, am nächsten Tag vielleicht mehr Platz zu haben um sich ausstrecken zu können. Auf brutale Weise mussten wir lernen, was im Menschen ist´, wie es beim Evangelisten Johannes heißt“.
Als der Zug wieder fährt, wird Louis Paraire krank.
Er ist, so seine Gefährten, trotzdem „wie immer bestrebt, um sich herum ein Klima der Nächstenliebe und einer sehr geeinten Brüderlichkeit zu verbreiten“. Nachdem erneut ein SS-Offizier Häftlinge beschossen hat, sind alle mit dem Blut der Getroffenen bedeckt.
Eloi Leclerc: „In dieser Situation kam uns der Gedanke, den Text des heiligen Paulus im Römerbrief mit neuen Augen zu lesen:
„, Was kann uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Not oder Verfolgung, Hunger oder Kälte, Gefahr oder Schwert? In der Schrift steht: Um deinetwillen sind wir den ganzen Tag dem Tod ausgesetzt; wir werden behandelt wie Schafe, die man zum Schlachten bestimmt hat. Doch all das überwinden wir durch den, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss: Weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Gewalten der Höhe oder Tiefe noch irgendeine andere Kreatur können uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn´“.
Massaker in Nammering
In Bayerisch Eisenstein erreicht der Zug am 18. April wieder Reichsgebiet. Endstation ist an diesem Tag Deggendorf an der Donau. Von dort wäre es möglich gewesen, Dachau auf direktem Wege zu erreichen. Aber der Bahnknotenpunkt Plattling am anderen Flussufer ist zwei Tage zuvor von amerikanischen Bombern völlig zerstört worden, die Strecke war blockiert.
Deshalb wird der Zug links der Donau in Richtung Passau umgeleitet.
Doch am 19. April beginnen „die schrecklichen Tage von Nammering“, wie Überlebende sie später nennen.
Weil kurz zuvor bei Tittling ein Wehrmachts-Transport entgleist ist, geht es auch auf dieser Strecke vorerst nicht weiter. Zehn Kilometer vor Passau geschieht ein Massaker. François Bertrand schreibt später: „Es regnet, es ist kalt, wir werden mehr als fünf Tage an diesem Ort bleiben, ständigem Schneeregen ausgesetzt. In den offenen Waggons steht das Wasser fünf Zentimeter hoch“. Während des Aufenthalts sterben 524 Häftlinge. Sie verhungern, erfrieren, ihr Leben erlöscht durch Erschöpfung, sie werden von der SS erschlagen oder erschossen und in einem Massengrab verscharrt. Weitere 268 Häftlinge, die bereits vor der Ankunft gestorben waren, werden verbrannt.
Es wären wohl noch mehr Todesopfer gewesen, hätte Pfarrer Johann Bergmann aus dem benachbarten Aicha nicht sein Leben riskiert, indem er trotz strengen Verbots zu Lebensmittelspenden aufrief. Auch Philippe Bouchards Leichnam kommt in das Massengrab. Nachdem die US-Armee den Ort erreicht hat, werden die Toten exhumiert und in Särgen erneut bestattet. Die sterblichen Überreste Philippe Bouchards und anderer Ermordeter werden schließlich 1958 noch einmal exhumiert und auf dem Ehrenfriedhof des ehemaligen KZ Flossenbürg endgültig beigesetzt.
Am 24. April ist die Strecke nach Passau wieder frei. Der Zug wird geteilt (nach anderen Quellen ist das bereits vor der Ankunft in Nammering geschehen). Eine Hälfte fährt mittags ab, die andere abends. Die hier genannten Zeiten beziehen sich jeweils auf den zweiten Teil. Nachts wird in Passau die Donau überquert. Über Fürstenzell geht es parallel zum Fluss nach Pocking. 21 Stunden dauert das. Heute schaffen Züge die kurze Strecke in einer Dreiviertelstunde. Noch in der Nacht stirbt vermutlich Jean Préhu bei einer Schießerei.
Der 25. und der 27. April werden in unterschiedlichen Quellen auch als Todesdatum genannt, als Todesort aber immer Passau.
Unsere Schwester, der leibliche Tod
Am Abend des 25. April erreicht der Zug auf einem Nebengleis den Bahnhof Pocking. Louis Paraire leidet schwer an Ruhr. Eloi Leclerc: „Mit unserem Bruder Louis geht es zu Ende. Seit dem Tod des Poverello [ gemeint ist der heilige Franziskus von Assisi] ist wohl niemand einen so gefassten und friedlichen, ebenso schmucklosen wie schlichten Tod gestorben wie er. Er empfing noch das Bruchstück einer konsekrierten Hostie, dann erlosch sein Leben unmerklich. Ein heiliges Geschehen hatte sich vollzogen. In diesem Moment sind sicher keine fröhlichen Lerchen über den Waggon geflogen [ wie es vom Sterben Franziskus´ berichtet wird], aber unser Bruder ist im Glauben und in der Geduld der Heiligen gestorben“.
Die Gefährten begleiten seine letzten Momente mit dem Sonnengesang des heiligen Franziskus, in dem es heißt
„Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod; ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. Wehe jenen, die in tödlicher Sünde sterben. Selig jene, die er findet in deinem heiligsten Willen, denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun“.
Vor der Weiterfahrt greifen amerikanische Tiefflieger tagsüber den Zug an. Die SS-Wachen schießen zurück. Hinterher heißt es, die Piloten hätten den Zug für einen Munitionstransport gehalten. Die Gefangenen in den offenen Güterwagen sind völlig schutzlos, aber auch in den Viehwaggons schlagen die Geschosse ein.
Am 27. April kommt der erste Teil des Zugs mittags am KZ Dachau an. Der Rest folgt in der Nacht gegen 1 Uhr.
In den Waggons werden 2310 Tote und 814 Überlebende gezählt. Pierre Harignordoqui wiegt bei der Ankunft in Dachau noch 32 Kilogramm.
Die „Begrüßung“ schilderte er später so: „Ein SS-Mann ergriff mich und warf mich auf die Straße, wo ich mit dem platten Bauch in eine Wasserpfütze fiel, die ich in großen Zügen austrank“. Mit Schokolade und Zucker bringen Mithäftlinge halbwegs wieder zu Kräften.
Am nächsten Tag, abends gegen acht sind die Befreier da.
Die französischen Geistlichen vergossen „unwiderstehliche Freudentränen“, aber Typhus und Fleckfieber grassierten auf dem Gelände. Es sterben noch etwa weitere 2000 Menschen nach der Befreiung an diesen Krankheiten.
Der Pfarrer aus dem Baskenland staunt über die Verteilung von Lebensmitteln: „Unglaublich! Jeder Häftling bekam ein halbes Brot und eine Fleischbrühe. Dann, Tag um Tag, nahmen die Portionen noch zu und wurden restlos gegessen“.
Er kritisierte aber auch: „Nach meiner Ansicht glaube ich, dass die Amerikaner es verkehrt machten indem sie den Ausgehungerten so viele Lebensmittel gaben. Davon starben viele, denn der Umschwung war zu schnell und radikal“.
Nach der Befreiung
Die überlebenden Franzosen kehren, sobald sie wieder halbwegs zu Kräften gekommen sind, heim nach Frankreich.
Jean-Pierre Fourmentraux wird 1948 zum Priester geweiht. Als Arbeiterpriester betreut er die Beschäftigten in einer Fabrik seelsorgerisch. 1954 wendet er sich von der Kirche ab und heiratet vier Jahre später. Er tritt in die Kommunistische Partei ein. In seinen letzten Lebensjahren bezeichnet er sich als Atheist und stirbt 2007.
Über das weitere Leben von Daniel Verbraeken gibt es im Internet keinen Hinweis.
Auch bei Eloi Leclerc haben die Jahre unmenschlicher Behandlung Spuren hinterlassen. Nachts wachte er oft schweißnass auf, seine Seele war voller Angst. Schreckensbilder verfolgen ihn. Dennoch setzte er sein Studium fort, legte 1946 die feierliche Profess im franziskanischen Orden ab und empfing 1948 die Priesterweihe. Nach einem weiteren Studium der Philosophie lehrt er bis 1982 Philosophie in Studienhäusern seines Ordens in Frankreich.
Von 1983 bis 1986 lebt er in einer Einsiedelei im Elsass und widmet sich dem Schreiben von Büchern über Spiritualität, Meditation und philosophischen Reflexionen. 1988 tritt er dem Kloster von Rennes bei, wo er weiter Bücher schreibt und Schulungen sowie Exerzitien leitet. 1999 wird er in das Haus der Kleinen Schwestern der Armen im bretonischen Saint-Malo aufgenommen. Dort stirbt er auch am 13. Mai 2016 als Autor von etwa 30 Büchern. Schon das erste, „Die Weisheit eines Armen“, hat ihm universellen Ruhm als „einer der größten franziskanischen Denker unserer Zeit“ gebracht.
René Boitier hat den Todestransport schwerkrank überlebt. Er atmete noch, als die Amerikaner das KZ Dachau befreien und auch noch am nächsten Tag. Auf der Liste der Sterbefälle des 1. Mai aber steht auch der Name René Boitier.
Quellen:
(Die Orts- und Zeitangaben beziehen sich meist auf Notizen von Francois Bertrand, der über den Todeszug geforscht hat. Andere Angaben, auch von Augenzeugen, weichen mitunter davon ab).
https://www.memoresist.org/resistant/
https://www.memorialgenweb.org/memorial3/html/fr/complementter.php?id=5441394
https://de.wikipedia.org/wiki/KZ_Dachau
https://stevemorse.org/dachau/dachau.html
https://www.gedenkstaette-flossenbuerg.de/de/recherche/archiv
https://arolsen-archives.org/suchen-erkunden/anfragen/ihre-anfrage/
https://www.kz-gedenkstaette-dachau.de/forschung-und-sammlung/archiv/
https://www.martyretsaint.com/martyrs-de-l
https://www.buchenwald.de/1071/
https://messes.info/lieu/64/saint-etienne-de-baigorry/saint-etienne
https://www.amazon.de/Peuple-Dieu-Dans-Nuit-Ned/dp/2220061825
https://franziskaner.net/tauwetter-die-zwoelf-lerchen/
http://causa.sanctorum.free.fr/martyrs_du_nazisme_3.htm
http://newsaints.faithweb.com/martyrs/Nazis2.htm
Gedruckte Quellen:
Weiler, Eugen; Die Geistlichen in Dachau. Missionsdruckerei St. Gabriel, A-2340 Mödling, 1971
Um finanzielle Unterstützung wird gebeten.
Spendenkonto
DE54 7005 1540 0280 8019 29
BYLADEM1DAH